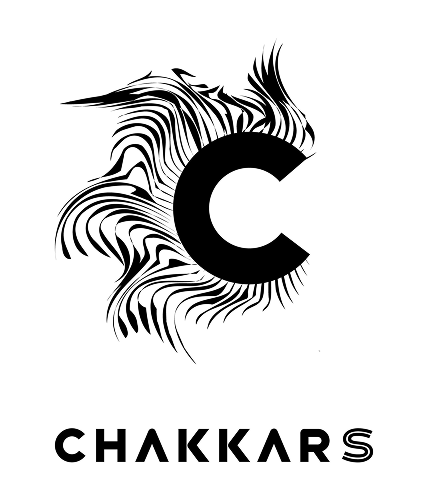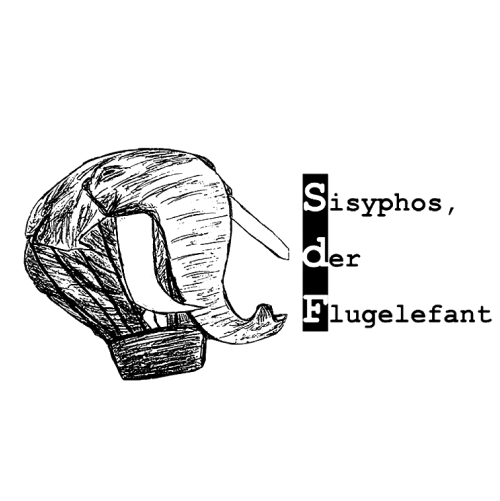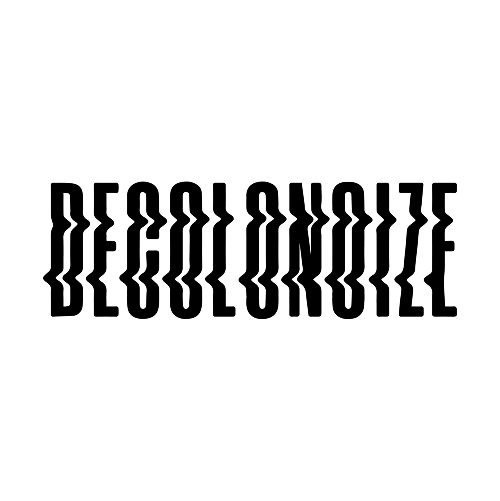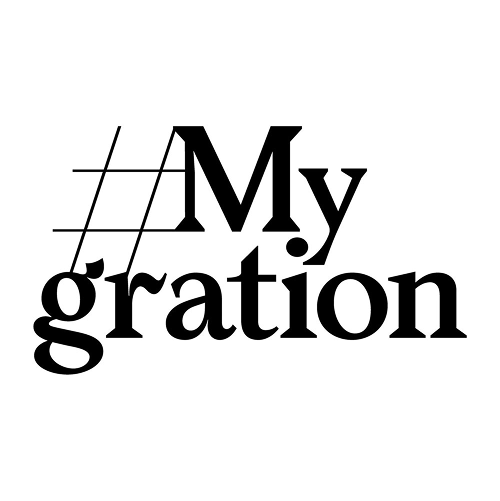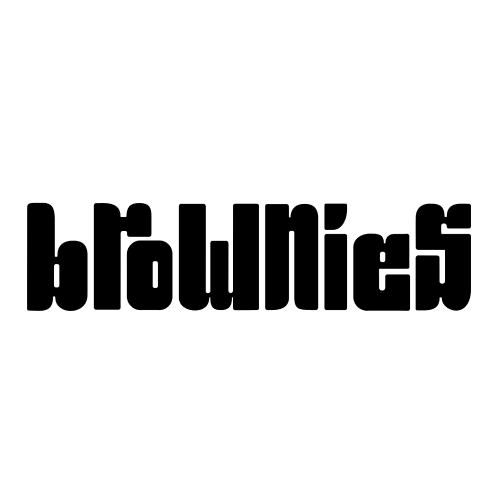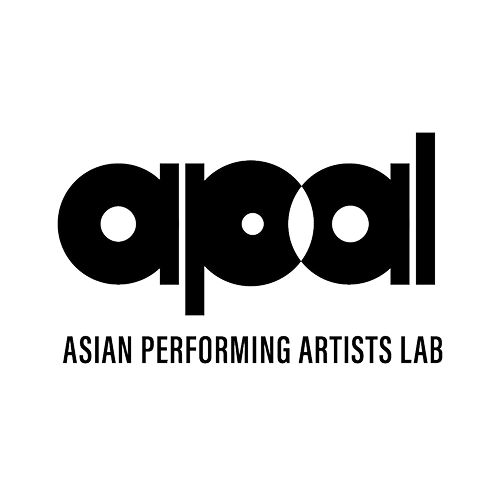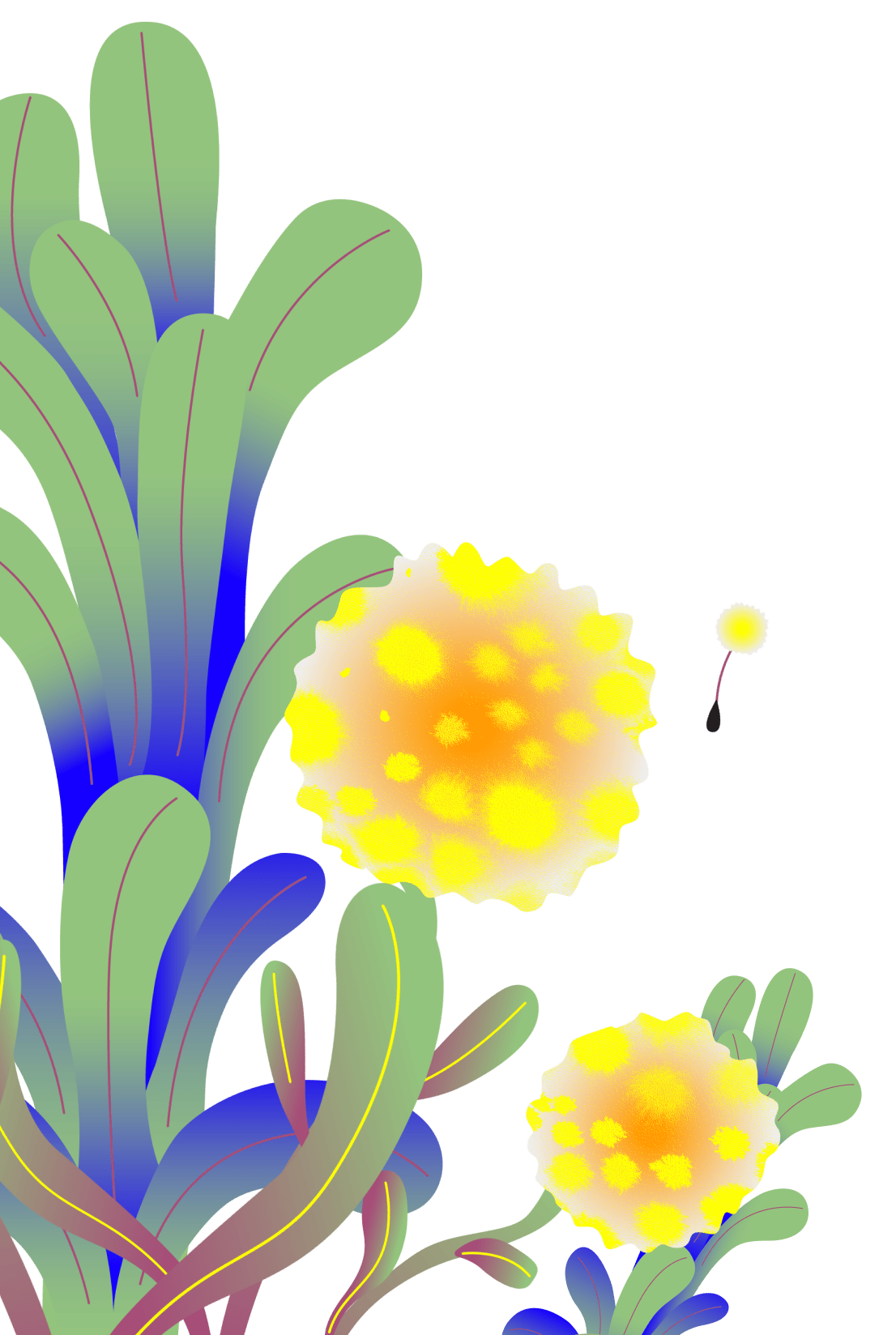
UNWerte
Einführung
Unsere Werte
Bei United Networks bilden unsere Werte das Fundament all unseres Handelns. Sie leiten uns in unserer Arbeitsweise, in unseren Verbindungen und in unserem Engagement – stets mit dem Fokus auf Gerechtigkeit, Solidarität und dem gelebten Wissen von rassifizierten und marginalisierten (RuM) Communities. Als werteorientierte Organisation setzen wir uns dafür ein, den Kunst- und Kultursektor gerechter, inklusiver und zukunftsfähiger zu gestalten.
Was unsere Werte bedeuten
Unsere Werte prägen sowohl unsere alltägliche Praxis als auch unsere langfristigen Ziele. Sie leiten uns dabei, wie wir Beziehungen aufbauen, Entscheidungen treffen und gerechtere sowie inklusivere kulturelle Strukturen denken. Noch wichtiger ist: Unsere Werte entwickeln sich gemeinsam mit unserem Team, unseren Partner*innen und Communities weiter – damit unsere Arbeit relevant, wirkungsvoll und auf nachhaltigen, systemischen Wandel ausgerichtet bleibt.
Unser Prozess zur Werteentwicklung
Unsere Werte wurden in Workshops und Gesprächen mit unseren Gründungsmitgliedern, Gesellschafter*innen, dem operativen Team und den Bündnispartner*innen in den Jahren 2021 und 2022 entwickelt. Im Jahr 2024 wurden sie von unseren Gesellschafter*innen – mit Unterstützung der Transformationsberaterin Yvette Robertson – weiter geschärft, um unser kontinuierliches Wachstum und den sich wandelnden Kontext widerzuspiegeln.
Unsere Werte leben
Wir verstehen unsere Werte als ein lebendiges Rahmenwerk, das mit uns wächst. Durch regelmäßige Reflexion und offenen Dialog mit unserem Team, unseren Partner*innen und Communities stellen wir sicher, dass diese Werte ehrlich, relevant und im Einklang mit unserer sich entwickelnden Arbeit und unserem Kontext bleiben.
unsere Werte in Aktion
unsere Werte in AktionP.I.S.C.E.S. Principles
Diese Kernbereiche zeigen, wie wir unsere Werte in die Praxis umsetzen – sie leiten unsere Arbeit im Hier und Jetzt und formen zugleich unsere Vision für die Zukunft.
Politische Wirksamkeit
Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse und Diskurse in der Kulturpolitik
Sichtbarkeit und Verständnis erhöhen
Aktivistische Arbeit sichtbarer machen und sicherstellen, dass Politiker*innen und Communities die Relevanz und Methoden von kulturell-politischem Aktivismus verstehen.
Künstler*innen und Communities einbinden
Wege finden, um mehr Künstler*innen und Community-Mitglieder in politische Diskussionen und Aktionen einzubeziehen und die Bedeutung politischer Bewusstheit hervorzuheben.
Sensibilisieren und Informationen verdichten
Informationen über kulturelle und politische Entscheidungen vereinfachen und verbreiten, um es allen Beteiligten zu erleichtern, auf dem Laufenden zu bleiben.
Geschichte anerkennen und nutzen
Die Bedeutung historischer Kontexte und Kämpfe betonen, um eine stärkere Grundlage für heutigen und zukünftigen Aktivismus zu schaffen.
Innovation
Ständige Entwicklung und Weitergabe von neuem Wissen, Werkzeugen und Herangehensweisen, um inklusive, kreative und wirkungsvolle Lösungen innerhalb unserer Community und darüber hinaus zu fördern.
Innovation annehmen und fördern
Wir verstehen Innovation als einen fortlaufenden, bewussten Prozess, der eng mit Problemlösung und Kreativität verbunden ist. Wir erkennen an, dass Lösungen für menschliche Herausforderungen komplex sind und Zeit benötigen. Wir lernen aus vergangenen Fehlern und nutzen diese Erkenntnisse für unser Wachstum.
Inklusivität stärken und Wissen weitergeben
Für UN bedeutet Inklusivität, Räume für unsere Communities – darunter migrantische und rassifizierte Gruppen – zugänglich zu machen, die sich für eine gerechtere Kulturlandschaft einsetzen. Dazu gehören Maßnahmen wie Kinderbetreuung, gemeinsame Vereinbarungen, Awareness-Teams und mehrsprachige Kommunikation.
Kommunikation über safer/braver spaces
Wir erkennen an, dass „sichere Räume“ in einem absoluten Sinne nicht existieren. UN arbeitet mit Community-Outreach-Personen und Netzwerkpartner*innen daran, gemeinsam mit den Teilnehmenden mutigere (braver) Räume zu gestalten, die sowohl unseren Standards als auch den Bedürfnissen der Beteiligten gerecht werden. Bei der Anmeldung erhalten alle Teilnehmenden einen Entwurf des Community Agreements und können Ergänzungen vorschlagen.
Werkzeuge für Klarheit und Effizienz einsetzen
Wir nutzen Tools wie Culture Amp für Feedback und Engagement und entwickeln Wissensdatenbanken, um kontinuierliches Lernen zu ermöglichen.
Solidarity
Förderung von Solidarität unter rassifizierten und marginalisierten (RuM) Communities sowie antirassistischen Verbündeten
Definition von Antirassismus und dessen Anwendung
United Networks orientiert sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen des Berliner LADG und AGG und erkennt die tiefe Verflechtung von Rassismus mit Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus an. Wir verfolgen einen intersektionalen Ansatz, setzen Antidiskriminierungsklauseln in Verträgen ein, streben inklusive Einstellungsprozesse an und stellen Awareness-Teams bei Veranstaltungen bereit.
Schaffung safer und braver Räume
Wir entwickeln klare Kriterien zur Bewertung von Sicherheit und Unbehagen, fördern schwierige Gespräche und erkennen unterschiedliche Bereitschaften für Veränderungen an. Unser „UN Hospitality Rider“, ein Gesprächseinstieg für braver spaces, wird 2025 veröffentlicht.
Brücken bauen und inklusive Beteiligung
Wir engagieren uns gemeinsam mit Partner*innen in kollektiven Aktionen. Bei der Veranstaltungsplanung beziehen wir marginalisierte Communities mit ein und richten uns nicht nur an dominante Gruppen. Wir binden vielfältige antirassistische Verbündete aus ländlichen Regionen und verschiedenen Sektoren ein, um breite und inklusive Unterstützung zu schaffen.
Interne Abstimmung und Reflexion
Regelmäßige interne Check-ins sorgen dafür, dass unser Team und unsere Partner*innen im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision und unseren Methoden bleiben. So fördern wir fortlaufende Reflexion und Anpassung, um inklusive und wirkungsvolle Solidaritätspraktiken nachhaltig zu gewährleisten.
Care
Förderung gegenseitiger Fürsorge und Bewusstheit über Machtverhältnisse innerhalb unseres Teams, unserer Communities und Partner*innen, um eine fürsorgliche Kulturlandschaft zu gestalten.
Förderung von Machtbewusstsein und unterstützender Teamkultur
Wir überprüfen kontinuierlich Machtstrukturen durch regelmäßiges Feedback, einschließlich monatlicher Umfragen und Abstimmungsrunden, unterstützt von externen Transformationsberater*innen. Teambuilding wird durch regelmäßige Retreats und gemeinsame Zielsetzungen gestärkt. Das operative Team wird durch professionelle Weiterbildung und externe Moderation gefördert.
Priorisierung von Wohlbefinden und Work-Life-Balance
Klare Grenzen werden gesetzt, um Burnout vorzubeugen, flexible Arbeitszeiten gefördert und gegenseitige Unterstützung für die psychische Gesundheit etabliert. Praktische Tools für effektives Aufgabenmanagement, regelmäßige Check-ins und Koordination helfen bei der Arbeitsbelastung. Freiwillige Mehrarbeit über die vertraglich vereinbarten Stunden hinaus ist auf maximal 10 Stunden pro Monat begrenzt, um die Belastung überschaubar zu halten.
Verbesserung klarer und transparenter Kommunikation
Intern und extern wird eine offene, zugängliche und zeitnahe Kommunikation gepflegt. Dialoge werden gefördert, um Missverständnisse zu vermeiden und alle Beteiligten über die Weiterentwicklung der Mission und den Werten von UN auf dem Laufenden zu halten.
Einbindung und Reflexion mit den Communities
Bedürfnisse und Rückmeldungen der Communities werden regelmäßig durch Umfragen und Gespräche ausgewertet. Die Teilnahme an Veranstaltungen wird durch den Abbau von Barrieren erhöht – etwa durch Kinderbetreuung, Barrierefreiheit und mehrsprachige Unterstützung – und marginalisierte Stimmen werden aktiv eingeladen.
Equity
Förderung von Chancengleichheit durch intersektionale Gerechtigkeit und geteilte Verantwortung
Vielfalt wird gestärkt und Inklusion wird gefördert
Es werden inklusive Einstellungsverfahren angewendet, durch die aktiv Menschen aus unterrepräsentierten und historisch marginalisierten Gruppen erreicht werden – darunter, aber nicht nur, queere LGBTIQA+ Personen, Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen, Migrant*innen und Geflüchtete, rassifizierte und marginalisierte Communities (Schwarze, indigene und People of Color), Studierende der ersten Generation sowie Menschen aus einkommensschwachen oder ressourcenbegrenzten Verhältnissen. Formate wie UN LAB & UNacademy bringen vielfältige Communities in mutige Räume für Dialog und Zusammenarbeit zusammen.
Barrierefreiheit und Transparenz werden priorisiert
Es wird eng mit Communities zusammengearbeitet, um praktische Maßnahmen zur Barrierefreiheit umzusetzen, wie Kinderbetreuung und mehrsprachige Unterstützung. Es wird klar kommuniziert, wie barrierefrei die Veranstaltungen und Ressourcen sind. Es wird anerkannt, dass die Auseinandersetzung mit ableistischen Praktiken ein fortlaufender Prozess des Lernens und Umlernens ist, und es wird sich verpflichtet, langfristige Strategien für einen sinnvollen kulturellen Wandel gemeinsam zu entwickeln.
Realistische und handhabbare Ziele werden gesetzt
Es werden klare, fokussierte Ziele definiert, die regelmäßig überprüft und im Team abgestimmt werden, um nachhaltige Fortschritte ohne Überforderung sicherzustellen.
Communities werden einbezogen und Verantwortung wird geteilt
Communities werden proaktiv in die Planung der Aktivitäten einbezogen und es wird für eine gerechte Bezahlung sowie Anerkennung ihrer Beiträge gesorgt. Es wird Transparenz bezüglich der Ressourcen und Kapazitäten hergestellt, um klare Erwartungen zu setzen. Antirassistische Verbündete werden ermutigt, die Arbeit zu teilen, damit die Belastung für rassifizierte und marginalisierte Mitglieder reduziert wird.
Nachhaltigkeit (Sicherheit)
Die Priorisierung von Sicherheit als nachhaltige Fürsorge für unser Team, unsere Organisation, den Kulturbereich und darüber hinaus.
Sicherheit als Teil der Nachhaltigkeit
Sicherheit wird in die nachhaltige Gesundheit der Organisation integriert, um Burnout vorzubeugen und langfristige Wirkung zu unterstützen. Es wird transparent kommuniziert, welches Unterstützungsniveau angesichts der verfügbaren Ressourcen möglich ist. Mutigere Räume werden gemeinsam mit den Teilnehmenden gestaltet, in denen alle Anwesenden die Verantwortung teilen, ein respektvolles und unterstützendes Umfeld zu bewahren – insbesondere für marginalisierte Stimmen – und sensible Themen mit Sorgfalt zu behandeln.
Transparente Kommunikation zu Veränderungen und Herausforderungen
Sprachliche oder inhaltliche Änderungen – wie die Umbenennung von „Sicherheit“ unter dem Begriff Nachhaltigkeit, der Wechsel von BIPoC zu „rassifizierten und marginalisierten“ (RuM) Gruppen oder der Ersatz des Unterstrichs (_) durch den Stern (*) in der geschlechtergerechten Sprache – werden klar erklärt, um Verwirrung zu vermeiden. Offenheit über Finanzierungssituationen, einschließlich der Abhängigkeit von temporären oder überwiegend weiß geführten Förderquellen, wird gewährleistet, verbunden mit dem Einsatz für nachhaltigere Finanzierungsmodelle.
Ganzheitliches Ressourcenmanagement
Ressourcen werden bedacht eingesetzt, um interne und externe Sicherheit zu gewährleisten, wobei akute Bedürfnisse mit langfristigen Zielen ausbalanciert werden. Prioritäten werden definiert und realistische Ziele entsprechend der verfügbaren Kapazitäten gesetzt.
Engagement für Nachhaltigkeit
Es wird mit politischen Entscheidungsträger*innen und relevanten Akteur*innen zusammengearbeitet, um sichere, langfristige Finanzierung und strukturelle Unterstützung zu fördern, damit gerechte Praktiken erhalten bleiben und weiter wachsen können.
Unsere Positionen
Unsere PositionenBasierend auf unseren Werten und unserer Vision haben wir im Jahr 2022 ein Positionspapier veröffentlicht, das drei zentrale Wege aufzeigt, um Barrieren abzubauen, die den Wandel hin zu einer gerechteren, inklusiveren und nachhaltigeren Kulturlandschaft behindern.
Diese Positionen sind auch heute noch von großer Dringlichkeit, und wir laden Entscheidungsträger*innen, Institutionen und Akteur*innen im Kulturbereich ein, sich uns bei ihrer Umsetzung anzuschließen – denn die Schaffung einer gerechteren Kulturlandschaft erfordert mehr als bloße Erklärungen; sie verlangt gemeinsame Verantwortung und kollektives Handeln.
Positionspapier herunterladen1.
Von der Marginalisierung ins Zentrum
Marginalisierung bedeutet Ausschluss von Ressourcen, Sichtbarkeit und Entscheidungsprozessen. Dem begegnen wir mit dem Vorschlag, Expert*innen aus rassifizierten und marginalisierten (RuM) Communities aktiv in die Entwicklung von Fördermaßnahmen, Gremien und Strukturen einzubeziehen.
Diese Einbeziehung soll:
– Als unverzichtbare Expertise anerkannt werden
– Gerecht finanziert werden
– Mit Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein: Partizipation muss über reines Symbolhandeln hinausgehen und echte Beteiligung ermöglichen.

Foto: Michael Tibes

Foto: Alexander Ourth
2.
Vom Lippenbekenntnis zur Verantwortung
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetze existieren – doch fehlt es häufig an deren konsequenter Umsetzung.
Wir fordern die konsequente Durchsetzung und transparente Überwachung rechtlicher Verpflichtungen wie:
– Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3
– Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
– Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
– Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG)
Öffentlich geförderte Institutionen sollten Verantwortung durch klare Berichterstattung, strukturelle Maßnahmen und Personalentwicklung nachweisen.

Foto: Sindi Zeneli

Foto: Sindi Zeneli
3.
Von historischer Verantwortung zu struktureller Transformation
Viele Institutionen reproduzieren weiterhin koloniale und hegemoniale Erzählungen. Der Aufbau einer gerechteren Kulturlandschaft erfordert einen bewussten Bruch mit diesen Traditionen und die Schaffung neuer, intersektionaler Perspektiven.
Wir empfehlen:
– Etablierung rechtlich verankerter Transformationspraktiken
– Nachhaltige Finanzierung von transformativer, struktureller Arbeit
– Festlegung von Intersektionalität als verbindliches Kriterium für Förderung und Evaluation
Transformation sollte über temporäre Projekte hinausgehen – sie braucht dauerhafte Ressourcen und strukturelles Engagement.
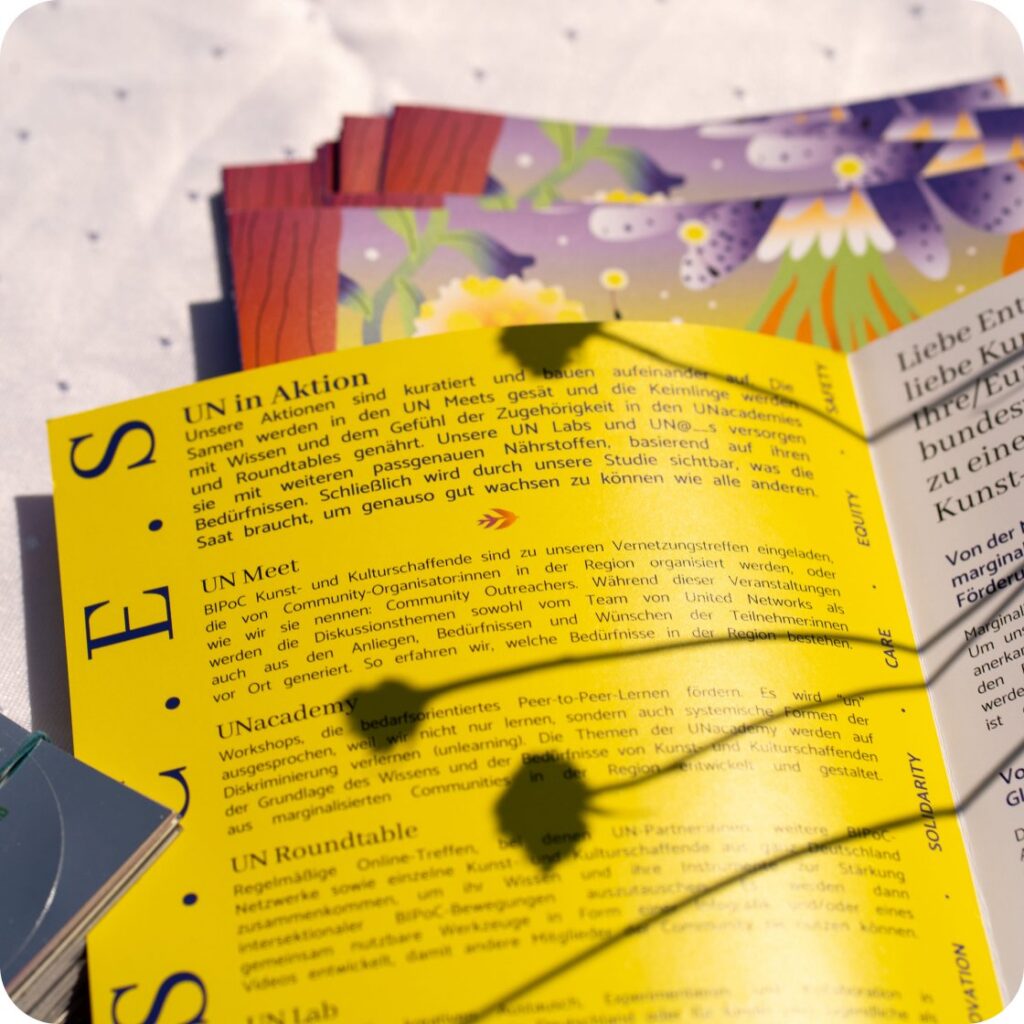
Foto: Sindi Zeneli

Foto: Yassine Jelassi
Unser Appell
Eine gerechte Kulturlandschaft kann nicht allein durch Repräsentation entstehen – sie erfordert strukturellen Wandel. Wir fordern politische Akteur*innen, Institutionen und Fördergeber*innen auf, Verantwortung zu übernehmen und Raum für echte Mitgestaltung zu schaffen.